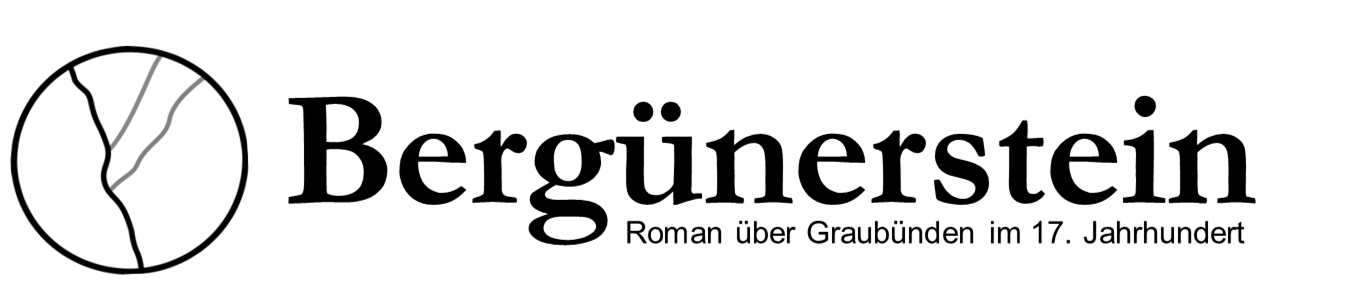Leseproben

Hier können Sie im «Bergünerstein» schmökern! Wahlweise am Bildschirm oder auf Papier, indem Sie die PDFs ausdrucken.
Die Leseproben stammen jeweils aus der Mitte der Erzählungen von Band I «Der Krieg» und Band II «Der Mord». Einiges wird daher nicht auf Anhieb verständlich sein. Aber keine Sorge: alles klärt sich auf, wenn Sie die Bücher in den Händen halten.
Klicken Sie auf die Überschriften und legen Sie los!

Bravuogn, 30. August 1608 a. S.
Download als PDF (5 Seiten)
Duonna Barbara schlug die Faust auf den Tisch, dass die Messer auf den Tellern klirrten und der Hund unter dem Tisch aufjaulte. «Das glaube ich dir einfach nicht! Du hast nicht richtig zugehört! Gib dir gefälligst mehr Mühe!»
Gian Pedrin wurde rot: «Wenn ichs doch sage: sie haben nichts gesagt! Niemand weiss etwas! Angiñ! Niemand weiss, wie sie losen werden, niemand weiss, wo sie die Lose versteckt halten, niemand weiss überhaupt, wo sie diese Nacht schlafen werden!»
Duonna Barbaras Augen wurden schmal: «Ingün, nicht angiñ. Und ich glaube dir nicht. Du willst nur nicht! Es ist dir einfach einerlei, wenn morgen dieser Krämerssohn die Podestaterei bekommt statt eines edlen Junkers aus unserem Stand!»
Nun war es an Giannin, auf den Tisch zu hauen. «Hör auf! Was ist nur in dich gefahren? Was fällt dir ein, meinen Sohn zu behandeln wie die Mitta? Und lass ihn reden, wie er will!»
Duonna Barbara erbleichte. «Ich behandle ihn nicht wie die Mitta, sondern wie einen jungen Mann aus gutem Hause, der seine Pflicht vergessen hat. Es ist unsere Verantwortung, dafür zu sorgen, dass morgen Jecklin die Podestaterei bekommt. Und da die Mats verstockt sind wie ein Ketzer auf dem Scheiterhaufen der Königin Isabel, ist Gian Pedrin unsere einzige Möglichkeit. Und wenn er es weder schafft, das Los ziehen zu dürfen, noch überhaupt herauszufinden, wie sie das Los ziehen wollen und wo es aufbewahrt wird, dann habe ich jedes Recht, wütend zu werden!»
Gian Pedrin warf seinen Löffel auf den Tisch und sprang auf. Die jüngeren Kinder hörten erschrocken auf zu essen. Mit rotem Kopf und Tränen in den Augen sagte Gian Pedrin, wobei sich seine Stimme bei jedem zweiten Wort überschlug: «Bap! Sie soll aufhören! Ich kann nichts dafür! Sie hat keine Ahnung, wie sie sind, mir sagen sie sowieso überhaupt nichts, weil sie…»
Giannin stand auf und legte seinem Sohn den Arm um die Schultern. «Żon Pepin, poret, beruhige dich, du hast nichts Falsches getan. Ich spreche mit ihr.»
Gian Pedrin zog die Nase hoch, starrte Duonna Barbara böse an und ging hinaus. Chiatrina stand auf, nahm Radu und Barbla an der Hand und verliess mit ihnen ebenfalls das Esszimmer. Nur Balz blieb sitzen.
Giannin sagte in scharfem Ton zu Duonna Barbara: «Du vergisst dich. Wag es nicht, noch einmal derart respektlos mit meinem Sohn zu reden!»
Duonna Barbara kniff die Lippen zusammen und sagte nichts. Dass Giannin sich nun plötzlich doch noch in die Frage der Podestatenwahl einmischte, war der Gipfel der Unverschämtheit! Aber ihr Schweigen schien Giannin noch mehr zu ärgern, denn jetzt schrie er: «Und überhaupt, wie du dich aufführst wegen dieser Wahl, das ist das letzte! Warum vertraust du nicht auf Jecklins Vorzüge? Im Gegensatz zu dir ist er ein ehrlicher, rechtschaffener Charakter, die Leute werden ihn deswegen wählen, und das Los wird gut entscheiden, so Gott will.»
Duonna Barbara wurde plötzlich von einem irren Lachen geschüttelt, obwohl ihr während Giannins Rede die Tränen der Wut in die Augen gestiegen waren. «Gott? Vertrauen? Giannin, verstehst du es immer noch nicht? Es wird gelost! Darum geht es doch! Eine Wahl würden wir gewinnen, es wäre ein Kinderspiel, aber um ein Los zu gewinnen, braucht es mehr als Vertrauen! Es braucht Wissen, und man muss eingreifen!»
Giannin verwarf ein weiteres Mal die Hände. «Eingreifen! Ja, das würde dir so passen! Ich muss sagen, ich habe grössten Respekt vor unseren Mats und vor Fallett. Seit Monaten schaffen sie es, weder deinen Praktiken noch denen von Cla auf den Leim zu gehen, und auch jetzt tun sie das einzig Richtige – sie verstecken sich und ihr Los. Geh es doch suchen! Los, steh auf, vielleicht sind sie ja in ihrer Acla? Wenn du jetzt losgehst, wirst sogar du sie noch im Hellen erreichen!»
Duonna Barbara stand auf und zischte: «Aha, jetzt willst du plötzlich auch noch mit Ideen kommen, du fauler Sack! Pultruñ!»
Giannin hob die Hand und machte einen Schritt auf Duonna Barbara zu, aber Balz sprang auf und stellte sich schützend vor seine Mutter. Der Hund knurrte drohend. Sie nahm Balz an der Hand, warf Giannin einen bösen Blick zu und verliess die Stube.
Eine Viertelstunde später stapften die beiden durch den halbdunklen Wald in Richtung Sagliaz. Duonna Barbara war bereits ziemlich ausser Atem, aber das war ihr heute einerlei. Die Bewegung in der kühlen Abendluft half, den Ärger mit Giannin zu vergessen. So zornig war sie gewesen, dass ihr sogar ein Bravuogner Fluch über die Lippen gerutscht war... Pultruñ, also wirklich... sie schüttelte sich.
Tatsächlich hatte sie selber auch schon daran gedacht, in der Acla der Mats nachzuschauen, hatte den Gedanken aber verworfen. So leicht würden die Mats nicht zu übertölpeln sein! Aber da ihr nichts Besseres eingefallen war und sie nach dem Streit mit Giannin unmöglich im Haus hatte bleiben können, war sie zufrieden damit, jetzt mindestens die Acla in Sagliaz zu untersuchen. Vielleicht würde sie dort einen Hinweis finden.
Balz sprang leichtfüssig neben ihr her, begeistert, so spät am Abend noch allein mit der Mutter unterwegs zu sein. «Mamma, warum ist der Bap so wütend geworden? Und Żon Pepin?»
«Gian Pedrin», korrigierte Duonna Barbara und holte tief Luft. Diese Kindernamen! Gian Pedrin war sechzehn Jahre alt! «Dein Bap hat eine andere Meinung, wie wichtig die Podestaterei ist und wie man sicherstellen muss, dass Gian Peder sie bekommt.»
«Aber ich mag nicht, wenn ihr streitet!»
«Ich weiss, ich weiss, cherign. Ich mag es auch nicht. Ich verspreche dir, morgen Abend, wenn die Wahl vorüber ist, streiten wir nicht mehr.»
Balz ging einige Schritte vor ihr her, drehte sich dann um und fragte weiter. «Warum ist es wichtig, dass Żon die Podestaterei bekommt?»
«Gian, nicht Żon.»
«Gian. Warum ist es wichtig, dass Żon – Gian, die Podestaterei bekommt? Marchett ist doch auch ein Edelmann?»
«Nein, cherign, Markett ist eben kein Edelmann. Ob jemand ein Edelmann ist, hängt nicht von den Kleidern ab oder vom Reichtum, sondern davon, ob seine Familie dem Adelsstand angehört. Und das tun die Pol Clos nicht, auch wenn die Ra – Mastrel Cla mit seinen Geschäften in Venezia viel Geld verdient hat. Die Jecklin dagegen sind adlig, deshalb heissen sie Jecklin von Hoch Realt. Wegen der Burg Hoch Realt.»
Balz überlegte mit gerunzelter Stirn. «Sind wir auch adlig? Haben wir auch eine Burg?»
«Ganz sicher! Die Familie Planta ist die vornehmste in den Bünden, vor allem in der Chadè. Du weisst doch noch die Geschichten von Armon, von Jacobus und den anderen Planta-Ahnen? Sie alle waren adlig, schon vor vielen hundert Jahren, lange bevor die Jecklin geadelt wurden.» Duonna Barbara blieb stehen, um etwas zu verschnaufen. «Weil wir schon so lange adlig sind, haben wir auch verschiedene Burgen. Für dich am wichtigsten ist natürlich das Schloss Wildenberg.»
«In Zernez? Bei Barba Raduolf?»
«Genau dort! Bald werden wir nach Zernez gehen und ihn besuchen und das Schloss Wildenberg anschauen.»
«Ist es eine richtige Ritterburg?» Balz hob einen Stecken vom Boden auf und fuchtelte damit in der Luft herum wie früher mit dem Holzschwert.
«Nein», lachte Duonna Barbara, «es hat zwar einen alten Turm, aber sonst ist es eher ein Schloss, bequem zum Wohnen. Heute ist es nicht mehr nötig, in Burgen zu wohnen, wir haben ja keinen Krieg.»
Balz machte ein enttäuschtes Gesicht und warf den Stecken weg.
Duonna Barbara fuhr fort. «Aber es gab tatsächlich eine Burg Wildenberg! Weit weg, im Oberland. Dort wohnten die Ritter von Wildenberg. Die waren sehr adlig und reich, und sie besassen noch viele andere Burgen und Schlösser, eben auch das in Zernez, das jetzt uns gehört. Und auch die Burg Greifenstein in Fallisur.»
Balz bekam grosse Augen: «Wirklich? Hat Barba Raduolf das Schloss mit dem Schwert erobert? Und warum hat er das in Falisogr nicht auch erobert? Dann könnten wir jetzt dort wohnen!»
Duonna Barbara lachte: «Fallisur, nicht Falisogr. Aber nein, cherign, Barba Raduolf hat sein Haus nicht erobert! Es gehört den Planta schon sehr lange, seit vielen hundert Jahren. Es ist eins der Lehen vom Bischof, erinnerst du dich?»
Balz schüttelte den Kopf.
«Ich erkläre es dir morgen noch einmal. Wir sind schon fast da – leise jetzt!»
Balz blieb stehen «Aber Greifenstein? Warum haben wir das nicht auch?»
«Greifenstein gehörte dem Bischof, bis… aber das erkläre ich dir wirklich besser morgen. Versprochen! Jetzt wollen wir schauen, ob wir in der Acla etwas herausfinden, gell?»
Balz nickte und flüsterte: «Ja! Wir erobern jetzt die feindliche Burg von Sagliaz!»
Duonna Barbara zog ihren Ältesten kurz an sich. Ganz offensichtlich schlug er ihr nach und nicht seinem pultruñ von Vater!
Leise schlichen sie im Schutz der Bäume näher an die Aclas. In derjenigen der Mats schien im Fenster ein schwaches Licht zu flackern! Duonna Barbara hielt den Finger an die Lippen, Balz ebenfalls, und auf Zehenspitzen schlichen sie zum Fenster. Zum Glück war es inzwischen schon fast dunkel!
Vorsichtig spähte Duonna Barbara ins Innere. Da – im Licht einer Talglampe sah sie drei Gestalten sitzen. Einer drehte ihr den Rücken zu, aber die anderen – das war doch Żongrond? Und… sein Name fiel ihr nicht ein, aber es war ebenfalls ein Mat, sie kannte sein Gesicht. Der dritte, dessen Gesicht sie nicht sehen konnte, musste Chiasper sein. Gian Pedrin hatte zur Genüge berichtet, dass die beiden erbitterte Feinde waren und deshalb beschlossen hatten, das Los gemeinsam zu ziehen. Der dritte war wohl ihr Gäumer… Nun, solange die drei wach waren, gab es nichts zu tun, aber sicher würden sie bald schlafen – es war schon spät!
Sie nahm die Hand von Balz und zog ihn zurück zu den Bäumen. Dort flüsterte sie ihm ins Ohr: «Wir müssen warten, bis sie schlafen!»
Balz nickte. Zusammen setzten sie sich unter einen Baum, auf die weichen Nadeln. Die Nacht war klar – man konnte die Sterne sehen, aber keinen Mond. Duonna Barbara fühlte sich zurückversetzt nach Morbegn, wo sie manche Nacht im Garten der Residenz verbracht hatte, mit Wein und Lautenmusik…
Nach einer Weile sagte Balz mit weinerlicher Stimme: «Mamma, es ist kalt, wie lange müssen wir noch warten?»
Duonna Barbara zog ihren Mantel aus, wickelte ihn um Balz und zog ihn auf ihren Schoss. «Schlaf nur, ich wecke dich, wenn es so weit ist.»
Und Balz legte seinen Kopf auf ihre Beine, und nach kurzer Zeit hörte sie, wie seine Atemzüge regelmässig wurden. Sie strich mit ihrer Hand über seine zerzausten Haare, schwarz wie ihre eigenen gewesen waren. Hoffentlich würde er nicht wie sein Vater schon mit 30 alle Haare verlieren! Und wie gross er geworden war, und wie schnell das gegangen war! Eben noch hatte sie ihn gesäugt, selber, ohne Amme, Giannin hatte darauf bestanden, denn er glaubte, die Poppi würden so eher überleben, und Balz hatte überlebt und kam jetzt mit ihr auf eine Expedition…
Ihr Rücken und Gesäss begannen zu schmerzen. Vorsichtig rutschte sie zur Seite und legte den Kopf von Balz auf den Boden. Sicher konnte sie noch einen Blick durch das Fenster riskieren?
Vorsichtig stand sie auf, wobei sie vor Schmerzen im Rücken fast aufschrie. Keuchend hielt sie sich am Baumstamm fest, an den sie sich vorher angelehnt hatte. Erst als sich ihr Atem beruhigt hatte, machte sie vorsichtig einen Schritt in Richtung der Acla – und blieb versteinert stehen, als mit lautem Krachen ein Ast zerbrach. Ein Tier heulte irgendwo – ein Wolf? Wieder krachte ein Ast. Da war noch jemand unterwegs! Wer konnte das sein?
Vorsichtig und mit zusammengebissenen Zähnen kniete sie sich hinter einen Felsbrocken, von dem aus sie gute Sicht hatte auf die Acla. Tatsächlich, da kam ein schwarzer Schatten herangeschlichen! Sie beobachtete, wie der Schatten zuerst durchs Fenster in die Acla hineinspähte, wie er dann zur Tür schlich und diese vorsichtig zu öffnen versuchte. Sie unterdrückte einen Fluch. Wenn das die Ratte war! Wenn er ihr nun zuvorkäme! Die Tür ging auf – und plötzlich zerriss ein fürchterlicher Schrei die nächtliche Stille und dann lautes Gelächter. Dann ging die Tür wieder zu, aber das Lärmen ging weiter. Duonna Barbara schlich schnell hinten um die Acla herum und der Wand entlang zum Fenster. Da, das Licht war wieder angezündet worden, heller diesmal, es mussten mehrere Lampen sein. Wieder spähte sie durchs Fenster.
Drinnen standen mindestens sechs Männer, lachend, und in der Mitte – Giargieli![4] Mit blutigem Gesicht und gefesselten Händen! Unwillkürlich entfuhr ihr ein kleiner Schrei – diese Teufel! Scheuten nicht davor zurück, einen Nachbarn zu verprügeln! Nicht, dass sie mit Giargieli das geringste Mitleid hatte, aber es hätte genausogut sie treffen können!
Sie wusste nicht, ob sie sich ärgern oder freuen sollte. Hier wäre heute nichts mehr zu holen, soviel war klar, aber mindestens war sie nicht erwischt und verprügelt worden. Nicht auszudenken, wie das Dorf über sie gelacht hätte! Hastig eilte sie zu ihrem Baum zurück, wobei sie über eine Wurzel stolperte und fast vornüber in die Tannennadeln auf den Boden gefallen wäre.
Gerade schaffte sie es noch in den Schutz der Bäume, da hörte sie, wie die Tür der Acla aufging und die jungen Männer gröhlten: «So, dann hast du ja jetzt, was du gesucht hast – wir wünschen dir eine schöne Heimkehr! Bis morgen auf dem Platz!» Und sie sah, wie der schwarze Schatten Giargieli davontorkelte – nicht mehr lautlos, sondern laut fluchend.
In diesem Moment wachte Balz auf und sagte schläfrig: «Mamma, mamma, was ist? Wo sind wir? Mamma, es ist kalt!»
Schnell kniete sie sich neben ihm nieder, hielt ihm den Mund zu und flüsterte: «Still, still, sie dürfen uns nicht hören!»
Balz begann zu weinen – und sie nahm ihre Hand wieder weg. Die Mats in der Acla waren so begeistert von ihrem Sieg über Giargieli, dass sie Balz sowieso nicht hören würden. Sie half Balz, aufzustehen, und zog ihn an der Hand davon, Richtung Dorf.
Endlich zu Hause angekommen, zog sie Balz die Stiefel aus, legte ihn in sein Bett und wankte auf schmerzenden Füssen in ihre eigene Kammer. Das Schnarchen Giannins in der Nebenkammer dröhnte durch den leeren oberen Sulèr.
Chur, Mai 1618
Download als PDF (3 Seiten)
Luzia sass in der warmen Werkstatt und haspelte. Windschnell liefen die Fäden über die Haspel, und Luzia träumte von den Engeln, deren Haar sie hier verarbeitete. Auch nach drei Jahren konnte sie sich am Glanz der Grège nicht sattsehen! Überhaupt liebte sie die Werkstatt und alles, was es darin zu tun gab. Mittlerweile durfte sie fast alle Arbeiten erledigen, ausser Weben.
Anfangs hatte es Herr Gioncada nur gestattet, wenn die Lehrbuben mit der Arbeit nicht nachkamen. Aber dann, als seine eigenen Töchter alt genug waren, um die Küchenarbeit zu übernehmen, hatte er sie immer öfter in die Werkstatt geholt, anfangs gegen heftigen Widerspruch der Webergesellen und der Lehrbuben, die sich beklagten, dass gegen die Regeln eine Frau ausgebildet werde statt eines weiteren Lehrlings. Doch Herr Gioncada wies seine Arbeiter zurecht: die Webergesellen ginge es nichts an, und die Lehrbuben sollten den Mund halten und sich mehr Mühe geben bei der Arbeit, um gleich geschickt zu werden wie Luzia.
Luzia kümmerte sich nicht um die Lehrbuben und hatte kein schlechtes Gewissen: die meisten Aufgaben hatte sie im Handumdrehen erlernt, viel schneller als die Lehrlinge, von denen über die Jahre mehrere gekommen und gegangen waren, man konnte also nicht sagen, dass Herr Gioncada sie ausbildete! Sie konnte nun die kurzen Bourettefasern aus der Schappe auskämmen, Bourette und Schappe verspinnen, Grèges haspeln und in verschiedenen Stärken verzwirnen. An den Webstuhl durfte sie nicht, das hätte die Schneiderzunft nicht zugelassen, erklärte ihr Herr Gioncada. Aber nach drei Jahren Beobachtung der Webergesellen kannte sie die verschiedenen Webarten der Seidenstoffe genau, Taft, Atlas, Organza, und hätte sich auch zugetraut, selbst mit dem Webstuhl zu arbeiten.
Abends in ihrer Kammer stickte sie beim flackernden Licht einer Talglampe, mit Fäden aus der Werkstatt auf fehlerhaft gewobenen Stücken oder Resten. Diese Stickereien waren weiss auf weiss, die Nadel wanderte über den Stoff und zeichnete Blumen, Kräuter, Bäume, Tiere, Muster… sehr genau wurden die Stickereien in dem schwachen Licht nicht, aber Luzia freute sich trotzdem über ihre Blumen und Tiere: sie nähte die Stücke zusammen und hängte sie vor das winzige Fenster, und wenn an Sommerabenden die Sonne hineinschien, sah es aus wie ein wunderlicher, weisse Garten!
In dieser Kammer, beschützt von den Blumen, von der strengen Sittlichkeit im Hause Gioncada und ihrem eigenen Strafdienst, den sie hier so gut durchführen konnte, schlief Luzia fast jede Nacht gut. Der Teufel besuchte sie nur selten, dafür träumte sie immer wieder schöne Träume, von ihrer Mutter, die bequem in ihrem warmen, hellen Grab lag und mit den beiden Kindern aus Schiers spielte, von den beiden Brüdern, die im glänzenden Harnisch auf stolzen Pferden ritten, die Taschen voller Gold.
Nach einem Jahr, als der gestickte Garten bereits die ganze Wand neben dem Fenster bedeckte, fühlte sie sich bereit, etwas ganz Neues in Angriff zu nehmen. Ausser Atem vor Aufregung kaufte sie aus ihrem gesparten Lohn farbige Seidenfäden auf dem Markt! Mit diesen wollte sie auf einem grossen Stück Abfallseide, das sie schon vor längerem von Herrn Gioncada erhalten hatte, ein Schultertuch sticken. Ein richtiges, schönes, farbiges, wie sie es manchmal bei vornehmen Damen auf dem Kornplatz sah.
Jetzt, nach weiteren zwei Jahren, war das Tuch fast vollendet. Schillernde Blumen wuchsen auf grün-grau glänzenden Stengeln und Ranken, dazwischen sassen und flogen Vögel, fast hörte sie sie zwitschern, so lebendig sahen sie aus! Mit diesem Tuch war sie nur sehr langsam vorangekommen, denn diesmal wollte sie genau arbeiten und konnte daher nur im Sommer, wenn es abends in der Kammer noch hell war, daran sticken. Dieses Tuch versteckte sie immer gut unter ihrem Bett, denn sie war sicher, dass Herr und Frau Gioncada entsetzt darüber sein würden: es war prachtvoll, sie würden es hoffärtig nennen. Auch Luzia selbst bekam manchmal Angst vor ihrem Tuch: so etwas würde sie nie, nie selber tragen können, denn der Teufel würde es sehen und sofort seine Klauen nach ihr ausstrecken… aber daran zu arbeiten, war schön!
Denn vor dem Teufel musste sie sich nach wie vor sehr in Acht nehmen! Täglich war im Hause Gioncada die Rede davon, wie sündig alle Menschen waren und wie schwach, und dass dies stimmte, spürte sie jedes Mal, wenn ein Lehrbub mit ihr zu sprechen versuchte oder wenn sie selten bei der Zubereitung von völlerischem Essen wie Fleisch oder Fisch helfen musste, wenn die Gioncadas Gäste hatten. Auf keinen Fall würde sie davon essen!
Aber abgesehen vom Essen und dem Schweigen in Gegenwart von allen Männern ausser Herrn Gioncada hatte sich die Form ihres Strafdienstes allmählich gewandelt. Sie hatte mehr Vertrauen zur Lehre des Herrn Calvin gefasst und aufgehört, zur Heiligen Luzia zu beten – obwohl sie oft an sie dachte. Die Heilige Luzia war das Vorbild der irdischen Luzia, ihr Entschluss, bis an ihr Lebensende keusch und jungfräulich zu bleiben, war unverändert, der tröstliche, feste Grundsatz ihres Lebens. Sie hatte weiterhin regelmässig gebetet, das Ave Maria allerdings nicht mehr, sie hatte, ermutigt von Frau Gioncada, in der Bibel gelesen, und sie war regelmässig zur Predigt gegangen und hatte das Abendmahl des Herrn eingenommen.
Alles in allem, dachte Luzia, weiterhin die Haspel drehend und mit den Augen den flirrenden Grègefäden folgend, war das Leben im Hause Gioncada sehr gut – fast so gut wie in einem Kloster mit Paramenten. Und irgendwann, eines Tages, würde der Bischof wieder glanzvoll in Chur residieren, und dann würde sie bei der Kathedrale Arbeit finden!
Die Stimme Herrn Gioncadas riss sie aus ihren Träumen: «Lucia, una Khundin per Uescha!» Und er kam, um sie an der Haspel abzulösen, ein Manöver, das sie in den letzten Jahren so oft geübt hatten, dass es jetzt ohne Unterbruch oder Änderung der Drehgeschwindigkeit klappte.
Luzia verliess die Werkstatt, um sich um die Kundin zu kümmern. Dieser Teil ihrer Arbeit gefiel ihr weniger, aber sie wusste, dass ihr diese Kenntnisse später bei der Arbeit in der Kathedrale nützlich sein würden: sie hatte gelernt, die unterschiedlichen Seidenstoffe zu waschen. Immer wieder kamen die Mägde vornehmer Häuser mit seidenen Kleidungsstücken ihrer Herrschaft, mit Wämsern, den Brusteinsätzen von Damenkleidern, Schultertüchern, Strümpfen oder gestrickten Kamisolen, manchmal auch mit seidenbezogenen Kissen. Die Mägde waren unsicher, wie sie die verfleckten Stücke reinigen sollten oder hatten bereits eines verdorben durch unbedachte Anwendung von Bürsten, Wasser und Seife. Auch die Wäscherinnen, die in den grossen Häusern die halbjährliche Wäsche der Leintücher, Tischtücher und Leibwäsche aus Leinen besorgten, konnten nicht weiterhelfen. Herr Gioncada wusste zwar, wie die Seide zu waschen war, mochte sich aber nicht damit beschäftigen. So wurde dies zu einer von Luzias Aufgaben – der einzigen, die ihr die Lehrbuben nicht streitig machen wollten.
Die heutige Kundin brachte ein seidenes Wams ihres Mannes, das vorne zahlreiche Fettflecken hatte. Luzia schauderte, wenn sie daran dachte, wie diese Flecken entstanden sein mussten: sicher hatte der Mann gevöllert, fetttriefendes Fleisch gegessen, viele Male... aber sie wusste, was gegen diese Flecken zu tun war: die Seide vom Futter lösen, die verfleckte Seide auf beiden Seiten mit Pulver aus gebrannten Schaffussknochen bestreuen und eine Weile ziehen lassen.
Solche Fälle kamen häufig, sie waren aber nicht so interessant. Viel interessanter war das Waschen der frisch abgehaspelten Rohseide, das Herr Gioncada auch immer öfters Luzia überliess: die Seide musste gewogen werden, für jedes Pfund Seide kam ein Viertelpfund von einem Pulver namens Alaun dazu, das musste über Nacht im Wasser liegengelassen werden, und am nächsten Morgen war die Seide wesentlich heller und schöner!
Luzia verabschiedete die Kundin mit dem verfleckten Wams und wollte Luzia in die Werkstatt zurückgehen, aber Frau Gioncada hielt sie auf: «Lüsia, gommsch in min Gammer?» Verwundert folgte ihr Luzia in den oberen Stock.
Frau Gioncada setzte sich auf ihr Bett und bedeutete Luzia, auf dem einzigen Stuhl im Raum, einem harten Holzschemel, Platz zu nehmen. Dann sagte sie: «Uan dü bisch gommen sü uns, dü bisch gsi ün Medschen. Aber jetz, dü bisch ün frou.»
Luzia erschrak: was wollte Frau Gioncada damit sagen?
Frau Gioncada sprach weiter: «Und dü bisch… voluptueuse.»
Luzia begann zu zittern. Voluptueuse? Das war ein schlimmes Wort! Was es genau auf deutsch bedeutete, wusste sie nicht, aber es hatte mit sündigen, hoffärtigen Frauen zu tun.
«Nein, ich bitte um Verzeihung, sagt mir, was ich falsch gemacht habe, es kommt nicht wieder vor!»
Frau Gioncada hob die Hand und sagte, sie müsse keine Angst haben, sie habe nichts falsch gemacht, sie benehme sich vorbildlich, wie es sich für eine fromme christliche Jungfrau gezieme, aber trotzdem sei es gerade jetzt wichtig, jeglicher Versuchung zur Sünde zu widerstehen, und deshalb wäre es gut, sie würde sich bald verehelichen.
Luzias Brust schnürte sich zusammen, das Zittern wurde stärker, sie bekam kaum noch Luft, im Kopf begann sich alles zu drehen. «Nein, Madame, bitte, ich bin noch viel zu jung und auch zu arm, ich bin gerne hier bei euch, ich gelobe, ich spreche nicht mit Männern, ich trage einen Schleier, damit keine Sünde entsteht, bitte, sagt nichts vom Heiraten…»
Frau Gioncada schien zu erschrecken und versicherte ihr hastig, sie wolle sie zu nichts drängen, natürlich müsse sie nicht gleich heiraten! Aber wegen ihrer Armut brauche sie sich nicht zu sorgen, sie und Herr Gioncada würden für eine kleine Mitgift besorgt sein, ihr Zeit geben, ihre Aussteuer vorzubereiten, sie würden ihr auch bei der Auswahl eines künftigen Ehegemahls helfen, es sei wichtig, dass sie einen anständigen, ehrlichen, frommen Mann nehme, der Gott achte und sie behüte und beschütze. Dann sagte sie noch, mit einem seltenen Anflug von Lächeln, ein Schleier sei nicht nötig, das sei papistischer Unsinn, aber es sei sehr wichtig, dass sie ihren Blick immer auf den Boden gesenkt halte und in Gegenwart von Männern nicht laut spreche oder lache. Dies versprach ihr Luzia von ganzem Herzen.
Brauegn, 2. Januar 1620 a. S.
Download als PDF (2 Seiten)
Bun de, bun on! Vor einem Jahr habe ich nichts notiert – ich war zu angewidert vom Strafgericht, das meine verehrten, hochgelehrten collegae in Tusaun angerichtet haben und das zum Neuen Jahr 1619 in seinem sechsten verbrecherischen Monat stand. Żanett natürlich, die Jungspunde Aliesch, Jenatsch, Lisander, und auch collega Buol, dem offensichtlich sein grosses Amt zu Kopfe gestiegen ist.
Und es ist gut, dass ich damals nichts geschrieben habe, denn wie immer hätte ich geschrieben, ich hoffe, im neuen Jahr würde alles besser, doch wie jedes Jahr wäre es anders gekommen: nämlich schlimmer. Das schändliche Treiben geht unvermindert weiter und feiert gegenwärtig auf Tavo fröhliche Urständ. In guter christlicher Gesinnung haben sie dort den Batrumieu Urschletta zuerst gefoltert und kurz vor dem Weihnachtsfest geköpft, der doch nur Diener eines verbrecherischen Herrn war.
Das Hauptgeschäft des Gerichts von Tavo ist es, die Urteile von Tusaun zu bestätigen und die Rechtssprecher des Coirer Gerichts von 1619 zu bestrafen, so wie es das Hauptgeschäft des Coirer Gerichts war, die Urteile von Tusaun zu kassieren und die dortigen Rechtssprecher zu bestrafen. (Das Hauptgeschäft des Gerichts in Tusaun war es, die Urteile des Chadi-Gerichts von Chavalier Raduolf von 1617 zu kassieren und die dortigen Rechtssprecher zu bestrafen.)
Zwischendurch haben die von Suot Valtasna, die sich irgendwie vernachlässigt gefühlt haben müssen, ihr eigenes Gericht aufgestellt und in Ermangelung wichtigerer Opfer – ich meine, Gegner – den Mastrel Fortunat Planta auf die Folter gezogen. Hauptsache, jemand mit dem Namen Planta kommt zu Schaden!
Ein munterer Reigen, den die Herrschaften aller Faktionen weitertreiben werden, bis alles Geld, das irgendwo zu holen ist, in den Taschen der Wirte verschwunden ist – wenn nicht der himmlische Vater dem Ganzen ein Ende setzt! Man sehnt sich ein Erdbeben, eine Pest, einen Krieg herbei, oder wenigstens einen Kometstern, Gott verzeih mir.
Lassen wir die grosse Politik, wenden wir uns unserer eigentlichen Aufgabe zu, der Seelsorge in Brauegn. Nur vier Hochzeiten letztes Jahr. Taufen weiss ich nicht mehr. Muss endlich ein neues Taufbuch kaufen. Ein paar Alte begraben, insbesondere natürlich Sar Peder Jecklin.
Ansonsten gibt es vor allem Misserfolge zu vermelden. Die Gemeinde ist zerstritten wie nie zuvor. Jedes der schändlichen Strafgerichte zählte bisher auch einen Brauegner Rechtssprecher in seinen Reihen, der dann vom nächsten Gericht verurteilt wird. Ich warte nur darauf, dass sie Sar Marchett abholen, der im Sommer unter Gamser in Coira geamtet und das schwere Verbrechen begangen hat, ein paar Verurteilte von Tusaun loszusprechen. Hier hat jede Seite ihre Anhänger, und wenn nur ab und zu eine Prügelei ausbricht, ist das noch nicht das Schlimmste. Die Beschädigungen an Feld und Tier, die immer mehr überhand nehmen, sind schlimmer. Einig ist man sich nur in der Gier und Faulheit: lieber lässt man sich von den Eidgenossen in Bern Geld und Getreide liefern, als selber die Felder zu bestellen. Dafür hat in Zeiten der Fähnlilupfe und Strafgerichte niemand mehr Zeit.
Selbst in Latsch und Stogl, wo man sich früher erholen konnte, streiten sie inzwischen erbarmungslos. Zum Glück muss mein Maultier das nicht mehr erleben!
Aber es gibt kleine Funken der Hoffnung. Ich habe nämlich angefangen, mitzustreiten. Ich erinnere mich selbst ein bisschen an den Jungspund Lisander, aber ich fühle mich sehr gut dabei! Laus Deo! Ich nutze die Kanzel, um gegen alle Strafgerichte zu predigen – nein, zu wettern! Ich predige – wettere – Freundschaft, Ehre und Vaterlandstreue! Bald donnere ich so laut wie Ser Gieri!
Und ich bin beglückt, hier privatim vermelden zu können, dass ich kleine Erfolge verzeichnen kann. Insbesondere die Frauen hören mir gut zu, und manch eine hat ihrem Mann die Leviten gelesen. Es scheint mir, dass die Zahl derer, die den Streit ablehnen, langsam steigt, und auch die Zahl der Anhänger Venezias.
Besonders stolz bin ich, dazu beigetragen zu haben, dass der junge Jecklin im Oktober wieder zum Mastrel gewählt wurde, mit Jochberg als Scrivaunt und Statthalter. Gegen das Gesetz, so ein Doppelamt, aber was ist schon das Gesetz in Zeiten von Streit und Span!
Angesichts der grossen Zerstrittenheit im Gericht haben Jecklin und Jochberg eine erstaunlich grosse Mehrheit erhalten. Ich vermute, dass selbst die Anhänger Venezias genug hatten von diesem Eiferer Steivan Linard, der versucht hat, die Busse, die ihm das Strafgericht vom Sommer in Coira auferlegt hat, durch die Gemeinde bezahlen zu lassen. Jecklin hat immerhin eigenes Geld…
Ausserdem wissen alle, dass seine Familie Verbindungen zu den Spaniolen hat, und das gilt mittlerweile als Vorteil, denn ich weise jeden Sonntag auf die Gefahr hin, die von den Bandierten ausgeht beziehungsweise der Weigerung der Scharlatane in Tavo, ihnen freies Geleit zu gewähren, und die Leute beginnen auf mich zu hören.
Man hört, der junge Plesch habe sich zum Henkersknecht machen lassen und prügle, stehle und brandschatze im Auftrag jedes Gerichtes, das ihm eine Mass Wein bezahlt. Fast bin ich froh, dass sein seliger Vater dies nicht mehr erleben muss, Gott hab ihn selig. Seiner Schwester sage ich nichts, sie ist schwachsinnig und versteht nichts.
Ich schliesse meine diesjährige Notiz nicht mit der Hoffnung, das kommende Jahr möge eine Besserung bringen, sondern mit der Voraussage, dass alles noch schlimmer kommen wird und die Herrschaften nicht ruhen werden, bevor sie das Vaterland zugrunde gerichtet haben. Amen.
Tavo/Brauegn, 10. Januar 1620 a. S.
Download als PDF (3 Seiten)
Im Januar erhält Plesch einen Auftrag: Er soll einen aus Brauegn abholen zu Verhör und Folter, einen, der wiederholt zitiert wurde, aber keine Folge geleistet hat: Baltisar Schalchett. Pleschs Kopfweh wird stärker, und abends gibt er der Jungfer sein letztes Geld, um ihr ein paar kräftige Faustschläge ins Gesicht verpassen zu dürfen. Dann fühlt er sich gestärkt und bricht am nächsten Morgen mit einigen Kameraden auf in Richtung Brauegn.
Man hat ihnen Pferde gegeben, damit es schneller geht. Sie traben durch den Schnee, der Weg ist gut gefestigt, es geht voran. Schon ist man in Falisogr. Dann talaufwärts. Dann der Aufstieg zur Pentsch: man muss absitzen und die Pferde führen. Männer und Tiere keuchen den Abhang hinauf, der Atem dampft, ein Pferd rutscht aus und stürzt um ein Haar in die eisige Alvra. Oben auf der Pentsch wirft Plesch einen kalten Blick auf die Nachbarschaft, auf den Schnee auf Zinols, unter dem sein Acker begraben liegt. Nun, wer braucht schon einen Acker, man ist jetzt Gäumer, und Brauegn eine Nachbarschaft wie jede andere, eine Nachbarschaft, in der sich ein spaniolischer Verräter versteckt, den man zum Verhör abholen muss.
Bald ist man im Dorf, und Plesch hält die Gruppe auf dem Platz an. Schaut sich um. Nur wenige Nachbarn sind unterwegs, und sie erkennen ihn nicht. Sein Haar und Bart sind lang und wild, und er hat den breiten Hut tief ins Gesicht gezogen. Er gibt dem Pferd die Sporen, reitet den Kameraden voran, dorfaufwärts. Da – sie stehen vor dem Haus der Schalchetts. Mehrere Fenster sind hell erleuchtet. Reiche spaniolische Verschwender!
Plesch steigt vom Pferd, die Kameraden ebenso. Sie klopfen ans Tor. Das Tor geht auf. Plesch zeigt dem Knecht ein Schreiben mit Siegel. Die Kameraden heben die Halbarten – Respekt! Eine dicke Frau kommt und schreit ihn an. Es ist Donna Barbla. Sie ist nicht gevierteilt oder zu Streifen geschlitzt, sondern so böse wie früher. Die Kameraden treten näher und senken die Halbarten, bis deren Spitzen in Donna Barblas Bauch stechen. Der Knecht verschwindet im Haus.
Nach einer Weile erscheint Balz, mit Schnauz und Bärtchen, in Mantel, Hut und Degen, küsst seine Mutter auf die Wange. Plesch zeigt mit seiner Halbarte auf den Degen, Balz nimmt ihn ab, gibt ihn seiner Mutter. Man wartet, bis ein Knecht ein Pferd für ihn bringt. Es ist still und kalt. Hinter Plesch sagt einer: «Plesch, bist du das? Was machst du hier?»
*
Plesch spürte, wie ihm schwindlig wurde und die Galle in den Hals stieg. Langsam drehte er sich um: da stand ein junger Mann in Herrenkleidung, mit einem angebissenen Hühnerbein in der Hand: Nuttin. Bilder stiegen auf in Pleschs Kopf: Blut im Schnee, die Steinbockfahne unter dem Fels am Blegs, böse Worte… sein Bauch begann zu rumoren. Er drehte sich wieder um. Er war hier, um einen Auftrag auszuführen. Donna Barbla im Zaum halten, Balz bewachen, dann losreiten. Wo blieb das Pferd?
Da packte ihn Nuttin von hinten an der Schulter. «Plesch, spinnst du? Was soll das hier? Was sind das für Leute?»
Donna Barbla rief hinter den Halbarten hervor, die immer noch in ihren Bauch stachen: «Schau ihn dir nur gut an, deinen sauberen Freund, er ist jetzt unter die Folterknechte gegangen. Schämt sich nicht, mit dem Siegel der Verbrecher auf Tavo einen Edelmann zum Verhör zu holen.»
Balz sagte in scharfem Ton: «Mutter, sei still!», während Nuttin fragte: «Folterknecht? Tavo? Ich glaubs nicht. Hast du keine Ehre mehr im Leib?»
Plesch fühlte durch das Kopfweh einen dumpfen Zorn in sich aufsteigen, wollte erklären, von Klägern, Rechtssprechern, Kundschaften, Schreibern, Klagepunkten und Urteilen, von Verrat und Vaterland, von bandierten Banditen, von der Gesandtschaft nach Prag, Freundschaft unter Protestanten, Nuttin wusste von diesen wichtigen Angelegenheiten nichts, aber die Worte lösten sich in Galle auf, bevor er sie auf die Zunge bringen konnte.
Dafür wurden seine Augen schärfer, denn plötzlich sah er, dass die Gasse, die ihm vorher so leer vorgekommen war, voller Menschen war, Nachbarn, die einen stummen Kreis um ihn und seine Kameraden gebildet hatten. Dieselben Nachbarn, die damals zugesehen hatten, wie seine Mutter genau hier den Verstand verloren hatte!
Plesch senkte seine Halbarte und zog damit einen Kreis um sich herum. Die Klinge glänzte schwach vom Licht aus den Fenstern der Ustaria. Die Nachbarn wichen zurück. Noch mehr Nachbarn kamen die Gasse herunter, sie redeten aufgeregt miteinander – und dann kam ein Schrei, eine Frauenstimme: «Plesch! Was machst du hier! Warum bist du nicht zu mir gekommen?»
Plesch kannte auch diese Stimme: sie gehörte Trina. Aber Trina war nicht hier, sie war in der Vuclina, und dort ging sie mit den Männern ins Heu!
Eine Frau sagte mit lauter Stimme: «Sie sind gekommen, um Balz zu holen! Nach Tavo! Sicher kommt er auf die Folter! Schande!»
Die Nachbarinnen fingen an zu tuscheln. Trina drängte sich durch den Ring der Nachbarn, packte seine Halbarte am Schaft, nahm sie ihm aus der Hand, warf sie auf den Boden, stellte sich vor ihm auf, sah ihm in die Augen, sagte: «Plesch, ist das wahr? Holst du ihn für die Folter in Tavo?»
Plesch sagte nichts. Trina wusste noch weniger von solchen Dingen als Nuttin, das Herrensöhnchen. Ausserdem ging sie mit Männern ins Heu.
Trinas Augen wurden grösser, füllten sich mit Tränen: «Plesch. Sag jetzt. Was machst du hier? Gehörst du zum Gericht auf Tavo?»
Plesch hob die Halbarte auf und drehte sich von Trina weg. Er hörte sie aufheulen, hörte die Nachbarinnen tuscheln und kichern, hörte Gieri ihren Namen rufen. Da kam endlich der Knecht mit dem Pferd für Balz, es war Rhaetus, auf den seit zehn Jahren alle in Brauegn neidisch waren.
Die Nachbarn traten beiseite, so dass der Knecht mit Rhaetus zum Haustor durchkam. Donna Barbla schrie auf, die Kameraden hoben wieder ihre Halbarten und drängten sie ins Haus zurück. Mit einem herausfordernden Blick in die Runde schwang sich Balz in den Sattel, gab Rhaetus die Sporen und stob davon. Plesch und seine Kameraden drängten sich fluchend durch die Nachbarn zu ihren Pferden, die nebenan in der Gasse warteten, kletterten auf ihre Pferde und galoppierten Balz nach.
Bald holten sie ihn ein, denn er wartete mit einem höhnischen Lachen bei der Brücke über die Tuors. Kaum hatte er sie erblickt, setzte er Rhaetus wieder in Bewegung, Rhaetus, der ausgeruht war und sich hier auskannte, er rannte im Halbdunkel den schmalen Weg zur Pentsch hinauf, als sei er in seinem eigenen Stall. Plesch und seinen Kameraden blieb nichts übrig, als ihrem Gefangenen hinterherzuhetzen und zu hoffen, dass er nicht plötzlich im Wald verschwand.
Plesch wäre es allerdings einerlei gewesen, wenn Balz verschwunden wäre. Der Blick aus Trinas Augen, Nuttins Hand auf seiner Schulter, sie hatten etwas mit ihm gemacht, den Nebel verscheucht und das Kopfweh, die wichtigen neuen Wörter des Gerichts. Und mit jedem holprigen Schritt seines müden Pferdes gruben sich Trinas nasse Augen mehr in ihn hinein und lastete Nuttins Hand schwerer auf seiner Schulter, so lange, bis sie ganz durch ihn hindurchgegangen waren wie durch ein Stück Butter und er das Gefühl hatte, in zwei Hälften zu zerfallen.
Warum war er so sicher gewesen, dass Trina in der Vuclina mit den Männern ins Heu ging? Warum hatte er sich geschworen, sie zu vergessen? Und warum hatte er Nuttin so sehr gehasst? Das war doch alles falsch? Aber es war einerlei, denn jetzt wollte ihn Trina sicher nie mehr sehen, und Nuttin hasste ihn noch mehr als zuvor. Denn auch Marchett hatte eine Zitation erhalten vom Gericht. Und alles wegen Balz!
Balz, der hochnäsige, der Anna misshandelt hatte, Balz, der Sohn der Hexe Donna Barbla, Balz, der ihn und die Kameraden und das Gericht verhöhnte – aber Trina und Nuttin hatten das Gericht auch verhöhnt, oder es mindestens für schändlich gehalten! Warum? Waren sie Spaniolen geworden? Das konnte nicht sein… Oder war das Gericht wirklich schändlich? Nein! Das Gericht war wichtig für das Überleben des Vaterlandes! Verräter mussten bestraft werden! Und wenn das Trina und Nuttin nicht passte, dann… dann…
Plesch sank zusammen. Alles war ihm zu kompliziert. Der Mond schien hell, die Sterne leuchteten vom Himmel, aber um ihn stieg wieder Nebel auf.
Tavo, Anfang September 1662
Download als PDF (2 Seiten)
September 1662. Cla von Jochberg, Mastrel von Brauegn, weilt in Tavo auf dem Bundstag. Er ist im Hause von Paul Sprecher zu Gast, dem Landammann von Davos. Weitere Gäste sind Landeshauptmann (Gubernator) Johann von Planta und Marteñ Clerig, Bundsschreiber des Gotteshausbundes, und seine aus Brauegn stammende Frau Chiatrina Schalchett. Gesprächsthema ist die schlechte wirtschaftliche Lage in den Bünden.
«Die Lage ist wirklich schlecht», sagte Sar Marteñ. «Ihr werdet am Samstag sehen, dass die Häupter einige Vorschläge haben, wie wir wieder mehr Kaufleute auf unsere Strassen bringen können. Zürich und Lindau hatten es ja versprochen, aber sie haben ihr Versprechen nicht gehalten, daher möchten wir jetzt härter vorgehen.»
«Das können wir schon machen», schmunzelte der Gubernator, «mehr Härte hat den Herren im Unterland noch nie geschadet. Aber die Lage wird sich erst bessern, wenn unsere Strassen besser sind.»
«Das stimmt, und auch dazu werden die Häupter am Samstag etwas sagen. Die Porten der Unteren und Oberen Strasse sollen auch etwas leisten, nicht immer nur fordern.»
Und zu Cla gewandt, fragte er: «Wie steht es eigentlich um euren Pass?»
Cla zuckte mit den Schultern. «Ach, ihr wisst doch, der Albula war immer schon kleiner als der Splügen oder Septimer. Bei uns wird nur wenig in Richtung Tiran und Bergamo transportiert, die Herren von Zürich und Lindau haben wohl noch gar nie von unserem Pass gehört …»
Donna Emerita kam herein mit einem grossen Braten auf einer silbernen Platte. Braten! Das gab es zu Hause selten, das Fleisch war meistens getrocknet oder geräuchert. Aber hier in Tavo wurde sicher das ganze Jahr über geschlachtet. Das Wasser lief Cla im Mund zusammen. Dieser Duft!
Pol Sprecher schnitt den Braten auf und verteilte kräftige Fleischstücke auf den Tellern aller Gäste. Cla schnitt ein Stück davon ab – Schweinefleisch! Es schmeckte herrlich, saftig, würzig … er nahm sich vor, besonders langsam zu kauen und jede Faser des Fleisches einzeln zu geniessen.
Auch die anderen Gäste schienen das Essen sehr zu geniessen, denn es wurde wieder ganz still am Tisch. Und dann, in diese Stille, sagte Sar Marteñ: «Sagt, erinnere ich mich richtig? Gab es nicht vor Jahren einmal ein Projekt in Bargün, eine flachere Strasse zu bauen? Um mehr Handelsverkehr über den Albula zu bringen?»
Donna Chiatriña legte ihre Gabel nieder und sagte, den Mund voller Braten: «Ja, aber das ist schon sehr lange her. Ich war ein kleines Kind damals. Die Strasse wurde auch gebaut, aber kurz bevor sie vollendet war, kam ein Felssturz, und sie wurde zerstört. Danach hat man es nicht wieder versucht.»
«Warum eigentlich nicht?», fragte Sar Marteñ. «Wer weiss, vielleicht könnte man mit einer neuen Strasse einen Teil des Handels über Albula fliessen lassen? Gerade wenn die Strassen am Splügen und am Septimer so schlecht dran sind?»
Cla sah die Gasse von Brauegn vor sich, vollgestopft mit beladenen Pferden, Reisenden aus aller Herren Ländern, in fremden Kostümen, fremde Sprachen sprechend, ein Duft von Gewürzen aus fernen Ländern mischte sich mit dem Bratengeruch … «Ja, das wäre wirklich schön, da habt ihr recht. Aber mit den gegenwärtigen Zuständen … das kostet viel Geld … die Kassen sind leer …»
Die drei Herren nickten, sahen einander an, den Braten für einen Augenblick vergessend – und dann, dachte Cla später, dann hatten alle drei gleichzeitig die gleiche Idee.
Sar Marteñ sprach sie aus. «Hans, das wäre doch etwas für dich und deinen Schwiegersohn?[1] Gebt der Gemeinde Bargün ein Darlehen, baut diese Strasse, damit helft ihr nicht nur Bargün, sondern uns allen. Nicht wahr, Sar Cla?»
Cla nickte begeistert. «Ja, das wäre eine gute Sache! Und nicht nur, weil wir dann mehr Kaufmanns-güter bekommen. Es wäre auch gut für die Nachbarn, wieder ein Projekt zu haben, bei dem sie am gleichen Strick ziehen können, etwas für die Gemeinschaft tun können, ein Gemeinwerk, das ihnen Freude macht. Es ist wichtig, in diesen Zeiten den Gemeinschaftssinn zu fördern und Streit und Miss-gunst im Keim zu ersticken.»
Sar Marteñ sah den Gubernator erwartungsvoll an, während Cla sich bemühte, woanders hin zu schauen. Man konnte den Gubernator nicht drängen oder gar anbetteln! Er versuchte wieder, den Geschmack des Bratens mit der Zunge zu erkunden, doch dieser schmeckte plötzlich wie Spiech.
Doch der Gubernator sagte nach nur kurzem Überlegen: «Donnerwetter, du hast recht! Der Commissari soll einen guten Einstand haben in Bravuogn, so ein Strassenprojekt, das ist genau das Richtige.»
Samedan, 18. Mai 1663 a. S.
Download als PDF (2 Seiten)
Mengia Stuppaun von Puntraschigna ist mit ihrem Vater in Samedan zu Gast an einem Festessen der Familie Salisch. Dort kommt es zu einer folgenschweren Begegnung …
Auf dem Platz waren schon zahlreiche Gäste versammelt. Einige sassen bereits an den langen Tischen, die man aufgestellt hatte, andere standen in Gruppen zusammen und redeten miteinander. Mengia erblickte Giunfra Maria Balastin, die sie vom Kirchensingen kannte. Sie winkte ihr zu, und Maria winkte zurück. Der Vater zog sie weiter, in Richtung des Hauses. Dort waren die Tische mit weissen Tüchern bedeckt, und es standen einige Herren und Damen in vornehmer Kleidung herum. Einige von ihnen kannte Mengia: der alte Sar Andreia Salisch, seine Frau, Duonna Lucia aus Clavenna, seine Tochter, Duonna Madlaina, mit ihrem Mann, Sar Gian Schucaun, dem Prädikanten von Samedan. Bei ihnen standen auch Sar Gian Salisch, zu dessen Ehren das heutige Festessen stattfand, und sein Bruder Sar Andreia Salisch. Die anderen Damen und Herren kannte Mengia nicht, wahrscheinlich gehörten sie auch zu den Familien Salisch, Planta oder Travers.
Der Vater begrüsste jeden der Herren mit Handschlag, und zu jedem sagte er: «Und meine Tochter, Giunfra Mengia, ihr erinnert euch.»
Mengia wäre am liebsten im Erdboden versunken. Aber sie liess sich nichts anmerken, murmelte bei jeder Vorstellung einen höflichen Gruss.
Nun waren sie bei Sar Lumbrain Planta angelangt. Der Vater versuchte, mit ihm ein Gespräch über die Reform der Zivilstatuten anzufangen, doch er winkte ab. «Lass uns später darüber reden, ja? Ich muss –», und er hatte sich schon wieder abgewandt und eilte auf einen vornehmen Herrn mit Federbarett zu. Als nächstes versuchte es der Vater bei Sar Fadri Salisch, doch dieser hörte ihn gar nicht.
Mengias Gesicht brannte, sicher war es dunkelrot. Sie schaute zu Boden, während der Vater sie weiterzog. Da rief jemand von hinten: «Dreja, warte kurz. Gut, dass ich dich hier treffe. Wegen der Kuh. Ist sie schon verkauft, oder können wir nochmal darüber reden?»
Der Vater blieb stehen und liess Mengias Ellbogen los. Sie machte schnell einen Schritt zurück, während der Vater mit dem Herrn, den sie nicht kannte, über die Kuh verhandelte.
Sie schaute auf dem Platz umher, um Maria wieder zu finden. Da sass sie, mit ihren Eltern, und winkte ihr wieder zu!
Mengia zupfte den Vater am Ärmel und fragte: «Darf ich dort hinüber gehen, zu Giunfra Maria?»
Der Vater nickte unwillig und wandte sich wieder dem Kuhkäufer zu.
Mengia ging zu Maria und begrüsste zuerst ihre Eltern, Sar Linard und Duonna Lionora. «Darf ich mich zu euch setzen? Der Vater ist noch am Geschäften.»
«Natürlich», sagte Duonna Lionora freundlich, «setz dich hier zu mir! Ist dir nicht kalt, ohne Wollenes?»
«Nein, es geht schon», murmelte Mengia.
«Oh, das ist aber schön!», sagte Maria und befühlte die Blumen und Ranken auf ihrem Kleid. «Hast du das selber gestickt?»
«N– ja», stotterte Mengia und spürte, wie sie wieder rot wurde. Maria könnte sie es ja erzählen, aber nicht auszudenken, wenn Duonna Lionora etwas über Amda Elisabetta zum Vater sagen würde!
Duonna Lionora sagte: «Komm doch wieder einmal zu Besuch bei uns. Das ist doch nichts für eine junge Frau wie dich, allein in einem Haus mit nur Männern.»
«Danke, das ist sehr lieb von euch. Aber ihr wisst, der Vater hat mich lieber zu Hause. Ausserdem bekommen wir eine neue Magd! Heute abend nehmen wir sie mit nach Puntraschigna.»
«Oh, wer ist sie?»
«Sie ist aus Bever und heisst Anna Gudeng Tack. Ravarenda Gian Peder hat sie empfohlen. Wir kennen sie noch nicht.»
«Dann hoffe ich, dass alles gutgeht mit ihr», sagte Duonna Lionora. «Wie lange war Ursina bei euch?»
«Oh, seit bevor ich zur Welt kam. Sie hat mich und Giuli aufgezogen, eigentlich.»
«Ach ja, bitte entschuldige. Natürlich. Deine Mamma ist ja jung gestorben …»
Nun kam auch der Vater zum Tisch und begrüsste Sar Linard mit Handschlag. «Sar Linard! Gut, dass ich euch treffe. Wegen der Statuten wollte ich sagen …».
Maria neigte sich zu Mengia und flüsterte: «Es tut mir leid, dass du nicht mehr hier singen kannst.»
Mengia zuckte mit den Schultern. «Ja, mir auch. Aber … ich verstehe ja, dass wir in unseren Heimat-gemeinden singen sollen, nicht anderswo.»
«Und die Herrenhäuser hier, sie haben jetzt sogar unter sich eine Vereinbarung geschlossen, dass nie mehr jemand von aussen dazukommen darf!»
Mengia wurde mulmig im Bauch. Wenn das der Vater hörte! Er war immer noch fest entschlossen, sie wieder nach Samedan zum Singen zu schicken.
Maria frage: «Singst du denn jetzt in Puntraschigna?»
Mengia zögerte. Die Wahrheit war zu peinlich … zum Glück sagte Maria plötzlich:
«Schau, dort drüben ist er.»
«Wer?»
Maria deutete unauffällig mit der Hand auf einen jungen Mann. Mengia erinnerte sich, dass Maria schon letztes Jahr von einem Mat von Samedan gesprochen hatte. «Und? Hast du …»
In diesem Moment schaute der junge Mann zu ihnen herüber und blinzelte ihnen zu.
Maria wurde rot. «Die Eltern haben mir versprochen, sie würden mit seinen Eltern reden.»
Mengia lächelte. «Dann wünsche ich viel Glück.»
«Und du? Noch niemand in Sicht?»
Nun wurde auch Mengia rot. «Nein, du weisst doch, der Vater will …» und sie schaute zum Haus, wo mittlerweile die vornehmen Damen und Herren an den weissgedeckten Tischen sassen.
Maria runzelte die Stirn. «Verzeih mir, wenn ich das sage … aber – denkst du, das ist wirklich möglich?»
Mengia wurde wieder mulmig. «Warum nicht?»
«Weil … also die von adeligem Stand, sie sind schon sehr, sehr reich, und du weisst doch, sie suchen die Frauen für ihre Söhne schon aus, wenn die noch Kinder sind …»
«Aber der Vater sagt …» Mengia gingen die Worte aus. Maria hatte gesagt, was sie selber auch immer öfter dachte. Besonders seit Ursina gestorben war. Der Vater sagte immer, die Stuppaun von Puntra-schigna seien genau so ein altes Bürgergeschlecht wie die Planta und Salisch, zudem hätten sie venedisches Blut und Güter und Juwelen und im Schwabenkrieg Ehre errungen. Und das stimmte alles, aber nach so vielen Jahren des Bemühens um eine solche Heirat hatte Mengia Zweifel, ob es die Planta und Salisch interessierte. Bald würde sie 27 Jahre alt werden …
Maria sah sie immer noch erwartungsvoll an – doch zum Glück wurden sie wieder unterbrochen.
Eine Gruppe junger Männer war von der anderen Seite an ihren Tisch herangetreten, sie trugen Weinkrüge und Becher und verteilten diese auf den Tischen.
«Bun di, bun di, schöne Jungfrauen», sagte der vorderste. «Erlaubt uns, euch unseren hervorragenden Vino da Tirano zu kredenzen.»
Er stellte Becher auf den Tisch, sein Kamerad schenkte alle Becher voll, und der dritte junge Mann verteilte die Becher. Als er Mengia ihren Becher übergab, berührten sich ihre Finger für einen Augenblick – und Mengia wurde vom Blitz getroffen. Schnell stellte sie den Becher vor sich auf den Tisch, die Hälfte des Weins schwappte über den Rand, und senkte ihren Blick. Ihr Atem ging so schnell, als sie sie auf die Alp hinaufgerannt. Was war das gewesen? Und – hatte jemand etwas bemerkt? Vorsichtig schielte sie zur Seite. Maria plauderte mit ihrer Mutter, die drei jungen Männer waren weitergegangen. Sie schaute ihnen nach. Welcher war es gewesen? Von hinten sahen sie alle gleich aus … da drehte sich der hinterste um, und seine Augen trafen die ihren. Noch ein Blitz!
Mengias Hände begannen zu schwitzen, überhaupt war es plötzlich sehr warm, das Kleid war zu eng.
Zum Glück begann in diesem Augenblick der alte Sar Andreia Salisch seine Rede! Dankbar drehte sich Mengia auf die andere Seite und hörte ihm zu.
Brauegn, 8. Juni 1662 a. S.
Download als PDF (2 Seiten)
In Brauegn wird das fromme Schauspiel «L’histoargia da Susanna» von Christoffel Brünett aufgeführt. Luzia hat die Kostüme dafür genäht, doch sie kann sich an der Aufführung nicht freuen: Ihr Enkelkind ist an Pocken erkrankt. Und die Geschichte von Susanna weckt in Luzia alte Ängste …
Endlich war die Predigt vorbei. Müde trottete Luzia den Chant hinunter, hinter den Vscheñs, die aufgeregt schwatzten. Susanna und Madlaina würden dafür sorgen, dass alle Kinder und Giunfra Anna richtig verkleidet waren, sie selbst durfte, oder musste, nur zuhören.
Auf dem Platz hatte die Żuanterna nun auch Bänke aufgestellt für die Planta und die anderen Vornehmen der Gemeinde. Die meisten von ihnen waren schon da: die Jochbergs, Sar Raduolf Schalchett, Sar Marchett Pol Clo der Alt und der Jung, Sar Nuttiñ und seine Kinder, die Keels vom Doppelhaus, dazu einige Vornehme von Falisogr und Żon Marchett Curè von Latsch. Neben Żon Marchett sass Donna Mierta mit Malgia. Luzia erinnerte sich, dass Żon Marchetts Mutter die Schwester von Donna Mierta gewesen war – Donna Mierta war also seine Onda.
Von der Bank vor dem alten Keelhaus auf der rechten Seite des Platzes winkte ihr die Rascherin zu. Luzia wäre lieber ganz hinten stehengeblieben, aber sie wusste, es war besser, sich zu ihr und zu Donna Anna Buol zu setzen. Gerade jetzt, wo Plesch wahrscheinlich nicht mehr lange leben würde … Die Rascherin, von denen von Zuoz, und Donna Anna Bossli Buol, die Frau von Sar Pol Buol, waren die führenden Damen von Brauegn. Was sie sagten, galt für alle Frauen – auch, ob man von Donna Lina Stickereien bestellen sollte oder nicht. Also setzte sie sich neben die Rascherin auf die Bank.
Der Platz war nun ganz voll mit Menschen. Die Kinder und Mats, die an der Aufführung mitmachten, warteten zuhinterst auf der Plattform und tuschelten aufgeregt. Vom Plazzet da Limaeris, wo Wirt Adam eine Sau am Spiess drehte, wehte ekliger Fleischgeruch herüber.
Zunächst sagt der Gubernator ein paar Worte. Rund um Luzia setzten sich alle Frauen gerader hin und schauten erfreut oder sogar lächelnd nach vorne. Als ob der Gubernator gleich Küchlein verteilen würde! Das war schon immer so gewesen, erinnerte sich Luzia. Der Gubernator, mit seinen Schlössern im Engadin, seinen edlen Pferden, seinen Gesandtschaften zu fremden Fürsten, war den Frauen im Dorf, und auch ihr selbst, vorgekommen wie ein Prinz aus einem Märchen. Er hatte gegen viele Mitbewerber Giunfra Maria Jecklin und ihr Land erobert und sie mit auf sein Schloss genommen, den Turm Wildenberg in Zernez. Als er anno 52 auch noch erreichte, dass sich die Zehn Gerichte und das Untere Engadin von den Habsburgern freikaufen konnten, kannte die Verehrung keine Grenzen mehr. Obwohl dies Brauegn gar nicht betraf, Brauegn war schon ganz lange frei, nämlich seit 1537. Diese Zahl hatte Luzia schnell gelernt, als sie nach Brauegn gekommen war!
«… so freue ich mich, mit euch, liebe Freunde von Bravuogn, die fromme Geschichte der tugendreichen Susanna erleben zu dürfen, in Verse gegossen von unserem lieben Ravarenda Christoffel Brünett», schloss der Gubernator seine Rede.
Nun stellte sich Sar Christoffel vorne an der Plattform auf und sagte, wobei sich seine Stimme vor Aufregung fast überschlug:
«Liebe Vscheñs, liebe Freunde, nach langer Vorbereitung ist es endlich soweit: Wir freuen wir uns, euch die Geschichte der Susanna vortragen und vorsingen zu können. Wir danken dem Signugr Gubernator für seine grosszügige Unterstützung unseres Schauspiels, wir danken Donna Lina für die schönen Kleider, wir danken allen, die das Schauspiel abgeschrieben und gelernt haben in den letzten Monaten.
Die Geschichte der Susanna haben Sar Peder und ich vorhin in der Predigt erzählt. Ob sie sich genau so ereignet hat oder ob sie als Lehrstück für uns so aufgeschrieben wurde, wissen wir nicht. Auf jeden Fall lehrt sie uns viel Wertvolles. Nehmen wir uns alle ein Beispiel an Susanna und Daniel!»
Dann trat Sar Christoffel in den Hintergrund, und die beiden Alten kamen nach vorne und begannen zu sprechen.
Luzia sass auf der Bank, trotz ihrer Müdigkeit in äusserster Anspannung. Auf keinen Fall durfte wieder dasselbe geschehen wie vor zwei Wochen! Zum Glück konnte sie von hier aus kaum etwas sehen und hören. Sie verschloss ihre Ohren gegen den Platz und sagte in ihrem Kopf die frommen Teile des Schauspiels auf, Susannas Worte … die Sonne wärmte sie, ihr Kopf sank gegen die Hausmauer …
Ein Ellbogen in ihrer Seite weckte sie. «Donna Lina», zischte die Rascherin, «aufstehen!»
«Oh, verzeiht», stammelte Luzia, «ihr wisst, Pleschett, ich habe die ganze Nacht bei ihm gewacht …»
«Natürlich», murmelte die Rascherin, sah aber irritiert aus.
Zitternd stand Luzia auf und folgte der Rascherin auf schwachen Beinen. Das ganze Volk zog vom Platz weg in Richtung Legs-cha. Denn der Teil, wo Susanna gesteinigt werden sollte, würde beim Galgenhügel aufgeführt.
Giosch Żender hatte extra eine Schneise in seine Wiese gemäht – gegen Kompensation natürlich –, und so zogen die Vscheñs von Brauegn und Latsch in einem schmalen Zug durch die Wiese und stellte sich unterhalb des Galgenhügels auf.
Luzia stand mitten in der Menge und schaute angestrengt nach oben, zu den steinernen Säulen des Galgens. Die Sonne brannte ihr auf den Kopf. Die Kinder und Mats auf dem Hügel redeten und sangen, Luzia konnte nicht alles verstehen, das Rauschen der Alvra war zu laut. Unauffällig liess sie ihren Blick über die Vscheñs schweifen, die angestrengt den Worten des Schauspiels lauschten.
«Te alg supplici da schdrappêr», kreischte Clauet Gregori mit dem Eselsbart vom Galgenhügel, «da t’faer mnaer, ett accrappaer! Ich lasse dich abführen und steinigen!»
Und wieder kam die Angst, stärker noch als beim letzten Mal, Zittern, schwarze Flecken, Übelkeit, keine Luft, ein Eisenring um die Brust, Luzia fiel ins kurzgeschnittene Gras …
Als Luzia wieder aufwachte, sah sie Donna Anna Buols Hand über ihrem Gesicht, die ihr Luft zufächelte. Zittrig stand sie auf und sagte: «Verzeiht … ich bin wirklich … ich muss wieder … ich muss zu Barbliña.»
Und sie wankte zurück zum Dorf, durch die Schneise im hohen Gras, über die Brücke, durch die Gasse hinauf zum Platz. Von dort eilte sie in die Stickstube, über den Plazzet da Limaeris vorbei an Wirt Adam, der ihr verwundert nachschaute, schlug die Tür hinter sich zu und verriegelte sie.
«Ich heisse Luzia, ich bin aus Schuders im Prättigau, ich war Näherin in Cuegra und habe den anderen Frauen geholfen …»